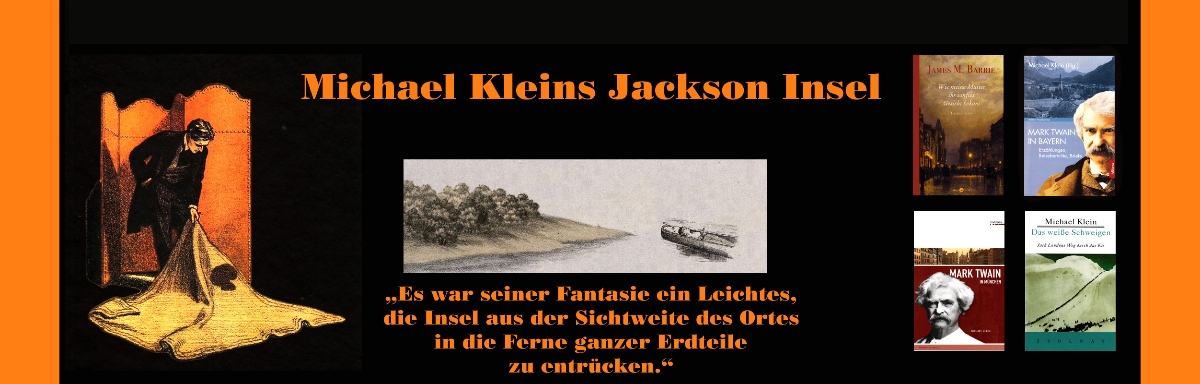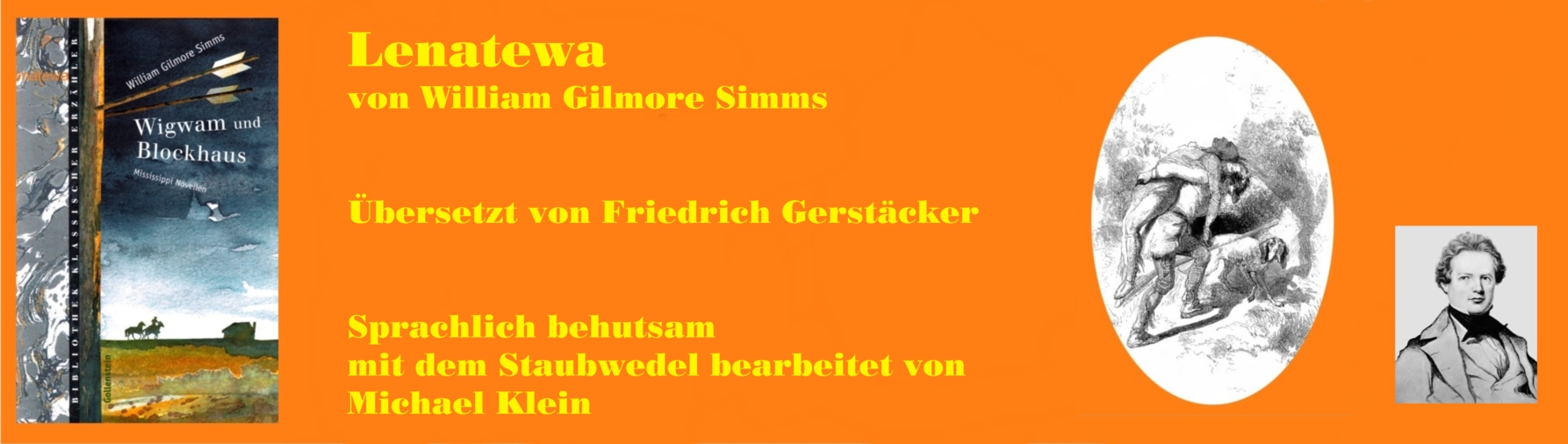
4. Kapitel
Sechs Wochen mochte der Junge auf solche Art bei uns zugebracht haben und fühlte sich mit jedem Tag besser, war aber doch noch zu schwach, als dass er die Ansiedlung hätte verlassen können. Während dieser Zeit nahmen die Unruhen der Indianer zu, und obwohl in unserer Nachbarschaft noch kein Blut vergossen worden war, hörten wir doch von allen Seiten von Morden und Skalpieren und konnten uns darauf gefasst machen, dass auch an uns die Reihe kommen werde. Wir trafen unsere Vorbereitungen, nahmen Munition ein und hielten abwechselnd Wache.
Schließlich schienen sich die Indianer auch unserer Gegend in Menge zu nähern. Jacob Ransom war auf eines ihrer Lager gestoßen, das sie zu diesem Zeitpunkt eben erst verlassen hatten, und es gab Ursache, das Schlimmste zu fürchten, besonders, da sie sich nicht offen sehen ließen, sondern nächtlich von Ort zu Ort zogen und unsere Hütten heimlich umschlichen oder im Dickicht versteckt lagen.
Eines Abends, als ich wie gewöhnlich von Clinch begleitet ausging, die Runde zu machen, und mich erst wenige Schritte von der Pforte entfernt hatte, stand der Hund still und bellte dumpf. – Jetzt wusste ich, dass Gefahr vorhanden sei, wandte mich ruhig um, ohne Eile oder Furcht zu zeigen, und erreichte noch glücklich das Blockhaus. Doch kaum hatte die Tür geschlossen, als die Indianer herbeistürmten, wütend, dass ihr Vorhaben, mich zu überraschen, misslungen war. Nur der scharfen Witterung meines treuen Clinch hatte ich es damals zu verdanken, dass ich und die meinigen die Sonne wieder aufgehen sahen.
Als die Wilden merkten, dass ihr Überfall missglückt war, erhoben sie ein gellendes Kriegsgeschrei, ein Zeichen, dass sie uns nun vollständig belagern würden. Bei diesem Geschrei erglänzten die Augen des Jungen, und er spitzte die Ohren wie ein Hund, der zuerst eine Spur des Wildes wittert oder das Horn des Jägers vernimmt. Ich beobachtete ihn genau und war im Zweifel, was ich tun solle; konnte er nicht, während ich gegen den äußeren Feind kämpfte, hinter meinem Rücken meine Frau und Kinder erwürgen? – Ich sagte euch nicht, dass ich am Ufer des Teichs, wo ich ihn fand, auch seinen Bogen und Pfeile aufgenommen hatte, und sein Jagdmesser steckte damals in seinem Gürtel. Sollte ich ihm nun seine Waffen nehmen? Und nahm ich sie, konnte ihm dann nicht ein Scheit Holz als ebenso gefährliche Waffe dienen?
In Zeiten der Gefahr drängen sich die Gedanken mit rasender Schnelle an unsrer Seele vorüber; so bestürmten all diese Betrachtungen mein Hirn, während mein Blick auf dem Jungen ruhte. Ich hielt es indes für das beste, ihm wie einem Freund zu vertrauen, da ich mir nicht denken konnte, dass er – nach allem, was wir für ihn getan hatten – falsch sein würde.
»Lenatewa«, sagte ich zu ihm, denn so nannte er sich, »dort sind deine Brüder.«
»Ja«, antwortete er langsam und richtete sich dabei hoch auf, denn er hatte ein stattliches, befehlendes Äußeres, einem Häuptling gleich, als dessen Sohn er sich auch zu erkennen gegeben hatte, »ja, das sind Lenatewas Brüder, soll er zu ihnen gehen?«
Dabei machte er eine Bewegung zum Fortgehen, doch ich hielt ihn zurück, nicht gesonnen, den Vorteil zu verlieren, den mir seine Anwesenheit als Gefangener in die Hände gab.
»Nein«, sagte ich, »nein, Lenatewa, heute Abend nicht, aber morgen, morgen magst du ihnen sagen, dass ich ein Freund und kein Feind bin, damit sie nicht kommen und meinen Wigwam abbrennen.«
»Bruder – Freund«, sagte darauf der Junge, mit Freimütigkeit meine Hand ergreifend. Er ging auch zu meiner Frau, tat dasselbe und wiederholte: »Bruder – Freund.« Ich beobachtete all seine Bewegungen und sagte zu Betsy: »Der Bursche ist redlich, sei ohne Furcht.«
Wir brachten eine schreckliche Nacht zu. Von Zeit zu Zeit ertönte das Kriegsgeschrei der Indianer, und durch die Schießscharten sahen wir, dass sie auf drei verschiedenen Seiten Wachfeuer angezündet hatten, um uns von den übrigen Niederlassungen abzuschneiden und jede Hilfe unmöglich zu machen.
Ich gab mich aber nicht der Verzweiflung hin, sondern arbeitete die ganze Nacht, und obwohl Lenatewa mir nicht half, saß er doch ganz ruhig oder streckte sich neben dem Feuer aus, als ginge ihn die ganze Sache durchaus nichts an. Mit Tagesanbruch aber hatte er jene blutigen Kleider angelegt, in denen ich ihn gefunden hatte. Alles, was ich ihm gab, hatte er beiseite getan, und obwohl seine Jagdkleider, die er jetzt trug, mit Blut und Schmutz befleckt waren, schienen sie doch mit solcher Sorgfalt und solchem Anstand geordnet, als habe er sich vorbereitet, Gesellschaft zu empfangen. Ich muss hierbei erwähnen, dass ein Indianer höherer Abkunft stets eine natürliche Würde und Grazie hat, wie ich sie nie bei einem Weißen gefunden habe.
Er war eifrig damit beschäftigt, durch eins der Schießlöcher zu schauen, und wenn ich auch nicht wusste wodurch, merkte ich doch bald, dass seine Aufmerksamkeit auf eine ganz besondere Weise in Anspruch genommen wurde. Ich entdeckte nun auch, dass er trotz meiner Wachsamkeit Gelegenheit gefunden hatte, sich mit denen draußen in Verbindung zu setzen. Anfangs begriff ich nicht, auf welche Art ihm dies möglich gewesen war, ich hatte aber seinen Bogen und die Pfeile vergessen. Von letzteren musste er einen durch die Schießscharte abgeschossen und daran ein Büschel seines Haupthaars befestigt haben. Die dadurch hervorgebrachte Wirkung war außerordentlich, und wir sahen während einiger Stunden keinen einzigen Indianer. Was sie während dieser Zeit taten, ließ sich nur vermuten, nämlich, dass sie Rat miteinander hielten – dass das Resultat dieser Beratschlagung der Tod eines ihrer Genossen anstatt des unsrigen sein würde, konnten wir nicht ahnen.
Als sich die Feinde wieder zeigten, kamen sie in zwei Abteilungen aus dem Wald hervor; sie hatten sich nicht völlig getrennt, bewegten sich aber doch nicht zusammen. Es schien, als ob sie uneins geworden seien.
Ihre gesamte Anzahl betrug etwa vierzig, von denen acht oder zehn, unter der Führung eines kräftigen, finster aussehenden Häuptlings, etwas abgesondert gingen; dieser hatte sein halbes Gesicht schwarz gefärbt und trug einen roten Kreis um beide Augen. Die anderen folgten einem alten weißhaarigen Häuptling, der mindestens sechzig Winter zählen musste.
Während ich vor einer Schießscharte kniete, um sie zu beobachten, kam Lenatewa zu mir, berührte meinen Arm und sagte: »Micco Lenatewa Glucco« – woraus ich erriet, dass dies der Vater oder Großvater des Jungen sei.
»Gut«, antwortete ich, indem ich zugleich bedachte, das Beste sei womöglich, ihr Vertrauen und ihre Freundschaft zu erlangen, »gut, Lenatewa, gehe zu deinem Vater, erzähl’ ihm, was Daniel Nelson für dich getan hat, und lass uns Frieden schließen. Du siehst, Junge, dass wir wohl kämpfen können, wir haben Waffen und Lebensmittel genug; und mit dieser Büchse könnte ich den Häuptling, deinen Vater, und jenen andern Häuptling, der sich so entsetzlich bemalt hat, niederschießen.«
»Schieß‘ nur«, sagte er schnell, indem er auf den Häuptling zeigte, von dem ich zuletzt gesprochen hatte.
»Ach, ist der dein Feind?«
Der Junge nickte mit dem Kopf und zeigte auf die Wunden an seinen Schläfen und in seiner Seite. Jetzt wurde mir die Sache klar.
»Nein«, sagte ich, »nein, Lenatewa, ich will keinen erschießen. Ich wünsche Frieden. Ich möchte den Indianern nur Gutes erweisen und ihr Freund sein. Geh‘ zu deinem Vater und sag ihm das; geh‘ und mach‘ ihn zu meinem Freund.«
Der Junge ergriff meine Hand, legte mir seine aufs Haupt und sagte: »Gut.«
Ich begleitete ihn bis an die Pforte; doch eh er die Hütte verließ, stand er einen Augenblick still und legte seine Hand auch auf den Kopf der kleinen Lucy. Ich war hierüber erfreut, denn es schien zu sagen: »Dir soll kein Leid geschehen, kein Haar deines Hauptes soll gekrümmt werden.« Ich öffnete ihm dann, schloss hinter ihm zu und eilte zur Schießöffnung zurück.
5. Kapitel
Der Anblick, der mich hier erwartete, war ebenso unerwartet wie fürchterlich. Sobald die Indianer den jungen Häuptlingssohn sahen, erhoben sie lautes Geschrei, doch konnte ich nicht erraten, ob aus Freude oder einem andern Grund.
Er schritt kühn vorwärts, obgleich er noch ziemlich schwach war, und der Anführer an der Spitze der zahlreicheren Partei kam ihm entgegen. Die kleinere Abteilung mit ihrem schwarzen Häuptling, von dem Lenatewa sagte, ich möge ihn erschießen, setzte sich ebenfalls langsam in Bewegung, doch schienen sie unschlüssig, ob sie näherkommen oder fliehen sollten. Ihr Anführer sah etwas verwirrt aus.
Sie hatten indes nicht lange Zeit zu überlegen. Denn als der junge Häuptlingssohn mit seinem Vater zusammengetroffen war und einige Worte mit ihm gewechselt hatte, sah ich, dass Lenatewa mit dem Finger auf den schwarzen Häuptling deutete. Hierauf erhob er seine geballten Fäuste und schien, seinen Bewegungen nach zu urteilen, heftig und erzürnt zu reden. Daraufhin erhoben mit einem Schlag die Anhänger des alten Häuptlings ihr Kriegsgeschrei, und die anderen Indianer fingen an, loszurennen, mit dem schwarzen Häuptling an ihrer Spitze. Er war aber noch kaum zwanzig Schritte weit gekommen, als ihn ein Hagel aus Pfeilen erreichte und zu Boden streckte.
Es war aus mit ihm. Und seine Anhänger zerstreuten sich nach allen Seiten, wurde aber nicht weiter verfolgt. Es schien, als wenn alle Pfeile nur auf ihn allein gerichtet worden wären und, nachdem er getötet war, die Sache beendigt sei. Das Ganze dauerte etwa fünf Minuten.
Fortsetzung folgt: Kapitel 6 demnächst an dieser Stelle.
Eine kurze Einführung zu William Gilmore Simms gibt es hier. Und auf diesem Weg geht es zum 1. Kapitel.
Der Text folgt weitgehend der 2002 erschienenen Buchausgabe „Wigwam und Blockhaus“ von William Gilmore Simms. Die Grundlage ist die Übersetzung von Friedrich Gerstäcker aus dem Jahr 1846. Sie wurde sorgfältig durchgesehen, gelegentlich verbessert bzw. behutsam um die kleine Staubschicht auf der Sprache von vor 170 Jahren bereinigt, eventuell von Gerstäcker vorgenommene kleinere Kürzungen wurden wieder rückgängig gemacht. Das Copyright dieser Textfassung liegt beim Herausgeber Michael Klein.