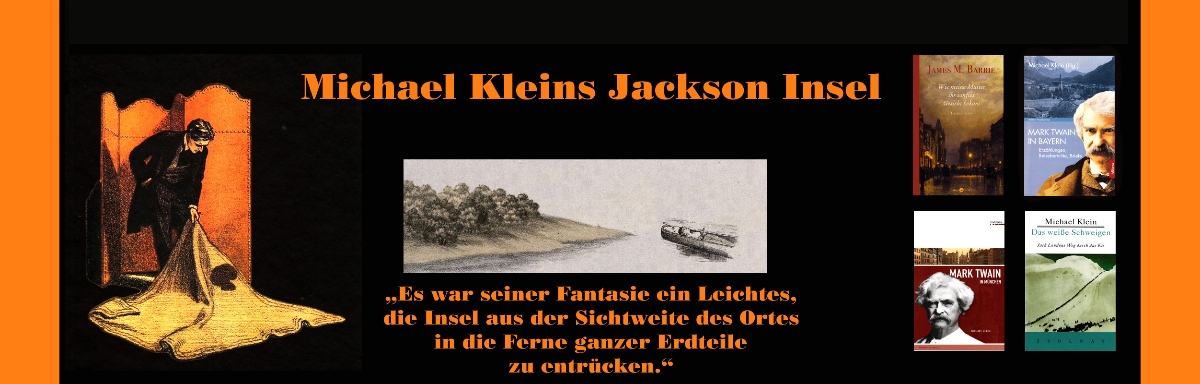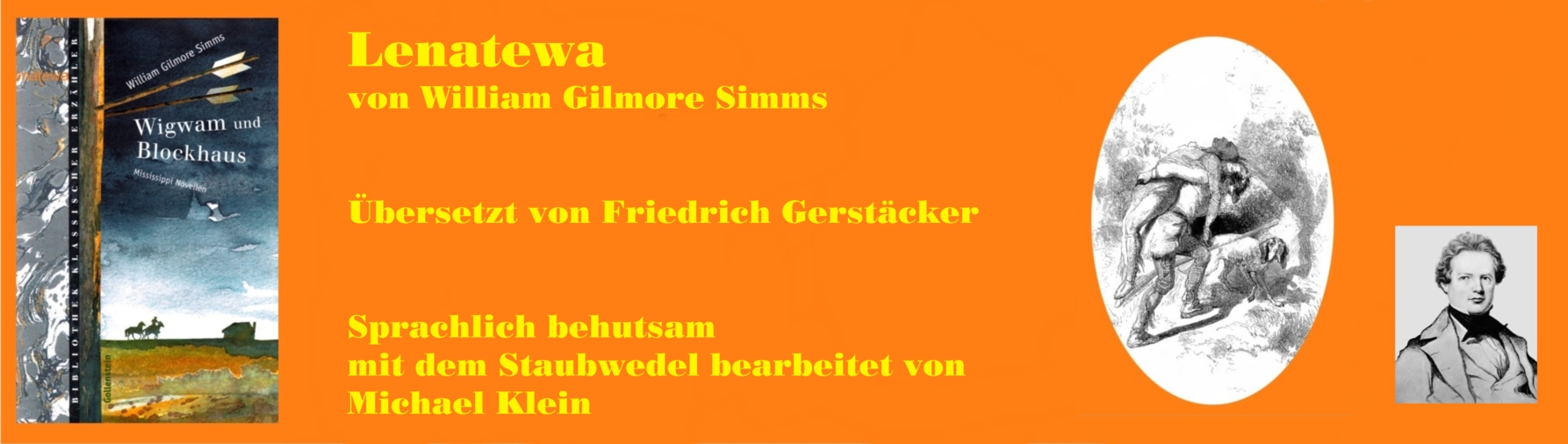
6. Kapitel
Alles gestaltete sich für uns nun glücklich. Lenatewa bewog den alten Micco rasch zum Frieden, der lediglich in die Feindseligkeiten eingewilligt hatte, weil jener schwarze Häuptling – ein Onkel des jungen Micco, der auch seine ganz eigenen Gründe gehabt hatte, ihn aus dem Weg zu räumen – ihm gesagt hatte, Lenatewa sei von den Weißen ermordet worden. Dies hatte den alten Häuptling zur Verzweiflung und zur Wut gegen uns gebracht. Als er nun die Wahrheit erfuhr und sah, wie freundlich wir seinen Sohn behandelt hatten, wusste er nicht genug zu danken. Er schwor, mein Freund zu bleiben, solange die Sonne scheinen, die Gewässer fließen und die Berge stehen würden, und ich glaube, der gute Alte hätte seinen Schwur gehalten, wenn er so lang gelebt hätte. Er hielt ihn jedoch bis zu seinem Tod, und ebenso sein Sohn, der ihm als Micco Glucco folgte.
Jahre vergingen, und wenngleich häufige Feindseligkeiten zwischen den Indianern und den Weißen stattfanden, berührten sie doch niemals unsere Niederlassungen. Lenatewa hatte seinen Totem an unsere Bäume gemacht, wodurch die Indianer wussten, dass diese Gegend unverletzbar sei.
Nach einem Zeitraum von elf Jahren indes wurde es anders. Der junge Häuptlingssohn schien unsere Freundschaft vergessen zu haben, und wir sahen ihn jetzt nie mehr unter uns. Unglücklicherweise hatten einige unsrer jungen Leute drei junge Krieger vom Ripparee-Stamm getötet, die beim Pferdediebstahl ertappt worden waren. Mich erfüllte das mit Besorgnis, denn ich fürchtete die Folgen, die uns dann tatsächlich erreichten. und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem wir es am wenigsten erwarteten.
Ich hatte alle Ursache zu hoffen, dass Lenatewa den Krieg von meiner kleinen Familie entfernt halten würde, dachte aber freilich nicht daran, dass er nur Häuptling eines Teilstammes und keineswegs der des ganzen sei. Der jetzige Krieg war allgemeiner Natur, und das gesamte Volk der Cherokesen war unter Waffen. Es leben auch wohl noch manche, die sich jenes schrecklichen Krieges erinnern und daran, wie die Bewohner Carolinas die Indianer zuletzt demütigten; doch ist hier nicht der Platz, von all dem Blutvergießen, von denen, die skalpiert wurden, und vom Elend, das Junge und Alte, Männer, Frauen und Kinder erlitten, zu reden.
Unsere Niederlassung war immer weitläufiger geworden, so dass wir endlich ein ansehnliches Blockhaus errichten mussten und dies mit Vorrat aller Art versahen, um uns im Notfall dahin zurückziehen zu können. Das taten wir, als wir durch unsere Späher erfuhren, dass sie Spuren der Indianer entdeckt hatten, und ließen dort unsere Frauen und Kinder unter einer sicheren Wache. Am Tage bestellten wir dann unser Feld und kehrten nachts zu unsern Familien zurück.
Auf diese Weise verlebten wir etwa fünf Wochen, ohne durch den Feind beunruhigt zu werden. Die Zeichen seiner Nähe verschwanden allmählich wieder, und wir glaubten, der Sturm sei glücklich vorübergezogen, ja vielleicht durch Lenatewas alte Freundschaft von uns abgewendet.
Dadurch ermutigt, ließen wir in unserer Wachsamkeit nach, die Männer brachten auch die Nächte auf ihren Besitzungen zu, und tags nahmen sie ihre Frauen, ja einige selbst die Kinder mit dorthin. Ich riet ihnen zu größerer Vorsicht, doch sie lachten mich aus und meinten, ich fange an, alt und furchtsam zu werden. Ich dachte zwar: »Wartet nur und seht dann, wer zuerst furchtsam ist«, da ich indes bei meinem Umherstreifen selbst auch keinen Indianer mehr entdeckte, fing ich an, die Meinung der übrigen zu teilen und nahm Betsy dann und wann mit mir auf unsre Besitzung – doch hielt sie vor mir geheim, dass sie einige Male mit Lucy allein, ohne irgendeinen männlichen Schutz, dorthin gegangen sei. Da unser Gehöft kaum eine halbe Stunde vom Blockhaus entfernt lag und wir von den Indianern nichts hörten oder sahen, schien ein solcher Gang nicht allzu gewagt zu sein.
Eines Tages hörten wir, dass sich etwa vier Meilen von den Ansiedlungen entfernt mehrere große Bären im Wald gezeigt haben sollten. Einige von uns – namentlich Simon Lorris, Hugh Darling, Jacob Ransom, William Harkless und ich – beschlossen, sie mit unseren Hunden zu verfolgen. Wir jagten die Bären auch mit Glück, und ich tat den ersten Schuss auf eine große Bärin, die größte, die ich je gesehen habe, verwundete sie leicht und folgte ihr dann eilends ins Dickicht.
Meine Gefährten hetzten den übrigen in verschiedene Richtungen nach und überließen es mir, mit meiner Beute fertig zu werden.
Mein armer Clinch war tot, und ich hatte jetzt zwei junge Hunde, Clap und Claw, mit mir, zu denen ich freilich bei einem Angriff des Bären nicht so viel Zutrauen haben konnte. Da ich jedoch das Tier hitzig verfolgte, dachte ich daran gar nicht, bis ich mich im Kampf mit ihm befand.
Ich prahle nicht, wie ihr wisst, aber das war ein Kampf! Der Bär hatte mich mit solcher Gewalt umfasst, dass mein Atem fast stockte, und nur der Gedanke an Betsy und die Kinder verlieh mir so viel Kraft, ihm mein Messer durch den Pelz zwischen die Rippen zu stoßen. Dadurch umklammerte er mich indes noch fester, und es wäre gewiss um mich geschehen gewesen, wenn er nicht eher als ich die Kraft verloren hätte. Erst sank seine Schnauze gegen meine Brust, dann seine Tatzen, und als er mich auf diese Weise losließ, fiel ich wie ein Kind nieder. Das Tier stürzte auf mich, doch kraftlos, ohne mir noch zu schaden. So lag ich fast eine halbe Stunde, der tote Bär neben mir, war aber fast ebenso unfähig, mich zu bewegen, wie er.
Als ich mich wieder erholte und aufraffte, hörte ich von den anderen Jägern nichts mehr. Ich fand mich allein mit meinen Hunden, und die Sonne begann zu sinken. Mein Pferd, das von mir außerhalb des Dickichts angebunden worden war, hatte den Zaum abgestreift und musste meiner Meinung nach entweder grasen gegangen oder nach Hause zurückgekehrt sein.
Diese Entdeckung war nicht gerade erfreulich. Auch wenn ich mich noch elend von der Bärenumarmung fühlte, überlegte ich doch, dass jetzt nicht die Zeit sei, stehen zu bleiben und zu stöhnen. Ich häutete den Bären ab, zerlegte ihn, nahm den Pelz mit mir und bedeckte das Fleisch mit Saumrinde. Darauf pfiff ich den Hunden und wollte mein Pferd suchen, dessen Spur ich tatsächlich eine Zeitlang folgte, bis ich mich sehr ermüdet fühlte. Es schien aus Schreck in vollem Galopp davongeeilt zu sein, und anstatt nach Hause zurückzukehren, war es zur anderen Seite ins Dickicht gelaufen und dann seitwärts abgedreht, bis ich seine Spur verlor. Ich hielt es für sinnlos, meine Verfolgung zu Fuß länger fortzusetzen, und eilte deshalb so schnell wie möglich dem Blockhaus zu.
Dies war indes keine leichte Aufgabe, da ich noch sieben starke englische Meilen wandern musste und die Sonne schon sehr tief stand. Ich überwand aber allmählich die Schwäche nach dem Kampf mit dem Bären, und obwohl mir die Füße müde genug waren, fühlte ich mich doch ansonsten wieder kräftiger. Die ganze Nacht lag ja vor mir, und den Pfad kannte ich genau; folglich setzte ich meinen Weg wohlgemut fort, mich hin und wieder ausruhend, meine Kräfte aufs neue zu sammeln. Ich trug etwas Brot und Zucker in der Tasche, was mich erquickte und für diesen Tag mein ganzes Mittagessen ausmachte.
Der Abend war völlig still, und wenn ich mich auch wunderte. nichts von Jacob Ransom und den anderen Jägern zu hören, beunruhigte mich das doch nicht sehr. Ich dachte natürlich, dass sie ihr Wild bis in weite Entfernung verfolgt haben würden. Noch mit solchen Vermutungen beschäftigt, hörte ich plötzlich einen Schuss, darauf einen zweiten, und dann war alles so still wie vorher. Ich sah nach meiner Büchse, nach meinem Messer und ging etwas schneller vorwärts.
Es mochte etwa eine Stunde verflossen sein, als es recht finster wurde und ich noch etwa vier Meilen vom Blockhaus entfernt sein musste. Der Himmel war ganz umwölkt, kein Stern sichtbar und die Luft feucht und unangenehm. Ich wünschte, sicher zu Hause zu sein, und fühlte mich unbehaglich, fast ebenso beängstigt wie in der Umarmung des Bären, doch war es jetzt nicht physischer Schmerz, sondern Seelenangst. Ich ahnte, dass ein Unglück geschehen sei, und indem mich dieser Gedanke heftig erfasste, stolperte ich über ein menschliches Wesen. Mein Blut erstarrte, als ich mich niederbeugte, seinen Kopf berührte und fühlte, dass er skalpiert worden war. Nun wusste ich, dass Gefahr drohte, und wenn ich auch nicht sicher erkennen konnte, wer der Tote war, vermutete ich doch in ihm einen unserer Jäger.
Hier blieb nichts anderes zu tun übrig, als vorwärts zu eilen. Ich empfand keine Müdigkeit mehr, und beim Gedanken an Frau und Kinder und was aus ihnen geworden sei, fühlte ich Kraft und Verzweiflung genug, jedem, selbst dem ungleichsten Kampf zu begegnen. Ich kann nicht sagen, dass ich feste Vorstellungen hatte, was geschehen war oder was getan werden könne; nein, ich wagte nicht daran zu denken, dass die Indianer beim Blockhaus gewesen sein könnten; aber es kam eine Angst über mich, die mich zu ersticken drohte, wenn ich daran dachte, wie sorglos wir unsere Frauen und Kinder auf unsere Besitzungen hatten gehen lassen. Ich war wie in einem Fieber, bald brennend und heiß, bald kalt und schaudernd, aber immer schneller eilte ich, alle Müdigkeit vergessend, vorwärts.
Jetzt hatte ich jene Hügelreihe erreicht, wo ich vor elf Jahren das sonderbare Lagerfeuer sah, und die Erinnerung daran kehrte lebhafter als je zurück. Während ich aber noch darüber nachsann, was diese wunderbare Erscheinung wohl habe bedeuten sollen, hatte ich die Spitze eines Hügels erreicht, von dem man bei Tage die ganze Gegend, etwa zehn Meilen im Umkreis, übersehen konnte.
Ihr könnt euch denken, wie erstaunt ich war, als ich auf der gegenüberliegenden Anhöhe – derselben, auf der ich damals die Erscheinung sah – jetzt wieder ein Lagerfeuer, aber ein wirkliches, erblickte. Die Flamme glänzte hell, obwohl ziemlich dicht von Buschwerk und Bäumen umgeben, und ich konnte Gestalten unterscheiden, in denen ich rasch Indianer erkannte. Es wurde mir etwas leichter ums Herz, als ich den Feind vor mir sah, weil ich jetzt wusste, was zu tun war. Ich wollte das Lager belauschen, um zu erfahren, was die roten Teufel beabsichtigten oder was sie bereits ausgeführt hatten, war zudem mittlerweile ein besserer Spion und Jäger als vor elf Jahren und glaubte, nahe genug kommen zu können und alles genau zu sehen, ohne mich durch irgendein Geräusch zu verraten. Die Hunde aber musste ich zurücklassen. Anbinden konnte ich sie nicht, denn dann würden sie geheult haben. Ich zog deshalb meinen Jagdrock aus und gab ihn dem einen, meine Mütze und mein Horn dem andern zu bewachen. Ich wusste, dass sie diese Sachen nicht verlassen würden. Dann sprach ich ein kurzes Gebet und schlich leise langsam vorwärts.
Wäre ich diesmal so unbesonnen gewesen wie das erste Mal, ich hätte meine Hütte nicht wiedergesehen; so aber kam ich ohne größere Schwierigkeiten nahe genug, um alles beobachten zu können, und jetzt wurde mir jene Erscheinung vor elf Jahren klar. Ich sah alles so deutlich, wie ich wollte, und deutlicher, als ich wünschte! Ich sah die Indianer das Feuer umlagern, sah die junge Frau in ihrer Mitte, und diese junge Frau war – meine Tochter, mein Kind, meine arme, teure Lucy.
Fortsetzung folgt.
Eine kurze Einführung zu William Gilmore Simms gibt es hier. Und auf diesem Weg geht es zum 1. Kapitel.
Der Text folgt weitgehend der 2002 erschienenen Buchausgabe „Wigwam und Blockhaus“ von William Gilmore Simms. Die Grundlage ist die Übersetzung von Friedrich Gerstäcker aus dem Jahr 1846. Sie wurde sorgfältig durchgesehen, gelegentlich verbessert bzw. behutsam um die kleine Staubschicht auf der Sprache von vor 170 Jahren bereinigt, eventuell von Gerstäcker vorgenommene kleinere Kürzungen wurden wieder rückgängig gemacht. Das Copyright dieser Textfassung liegt beim Herausgeber Michael Klein.