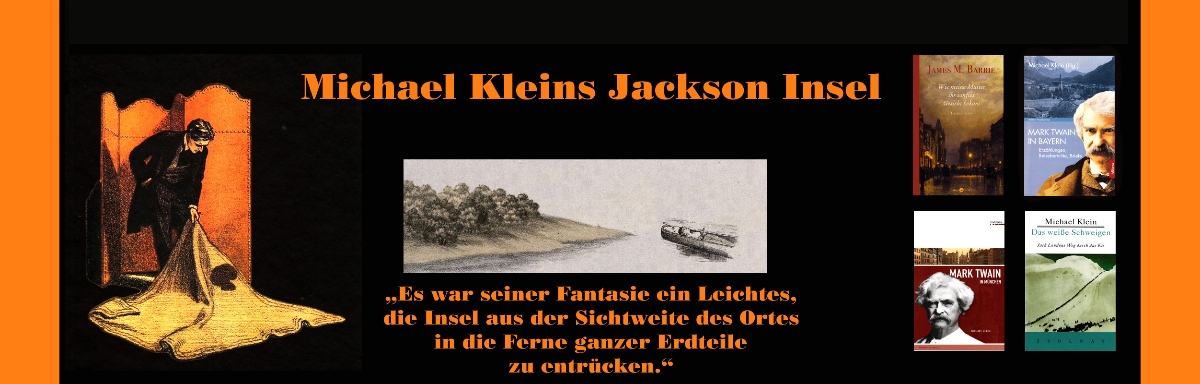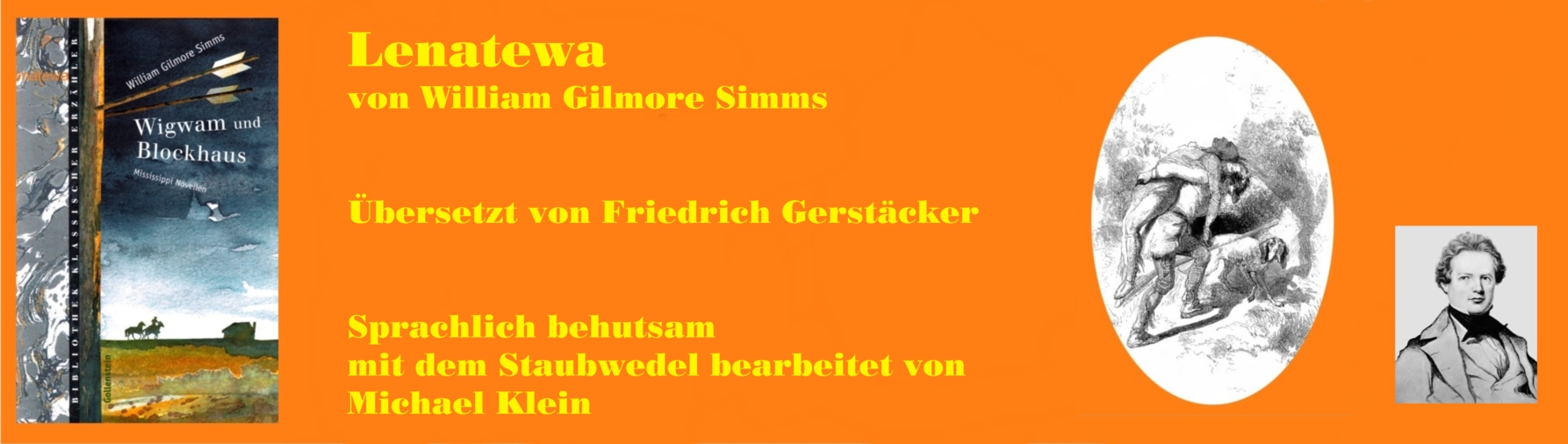
7. Kapitel
Welch ein grässlicher Anblick dies für einen Vater ist, kann lediglich ein Vater begreifen.
Da lag ich auf meinen Händen und Knien unbeweglich, fast besinnungslos, und es verging fast eine halbe Stunde, in der ich völlig erstarrt dalag. Nur die großen Tränen, die langsam meinen Augen entquollen, bewiesen, dass noch Leben in mir war. Ich versuchte zu beten, aber ich vermochte es nicht. Ich konnte meinen Blick nicht abwenden von jenem Platz, an dem mein Kind saß, und ich wurde immer stärker davon überzeugt, dass Handeln von meiner Seite aus fruchtlos bleiben müsse. Was konnte ich, ein einzelner Mann, nur mit Büchse und Messer bewaffnet, gegen die Übermacht ausrichten? Und hätte ich auch den stärksten jener Burschen niedergeschossen – wozu? Es wäre lediglich unnütz Blut geflossen, und ich hätte ja diese roten Teufel so gern in alle Ewigkeit leben lassen, wäre nur meine Tochter gerettet gewesen.
Was tun? Zum Blockhaus zurückkehren? Wusste ich denn, ob noch eine Seele am Leben war, oder ob nicht die Indianer schon dort gewesen waren? Und wohin sonst konnte ich mich um Hilfe wenden? Nirgends, nirgends als zu Gott! Ich stöhnte – so laut, dass ich zu fürchten begann, man höre mich. Allesamt waren indes eifrig mit dem Essen beschäftigt. Nur die unglückliche Lucy in ihrer Mitte saß so bleich, so verzweifelnd da, wie ich sie schon vor elf Jahren gesehen hatte.
Ich wandte mich ab. Ich konnte den Anblick nicht länger ertragen, ging den Hügel hinunter und warf mich zu Boden, ächzte und raufte mein Haar, als ob mir das etwas geholfen hätte.
In diesem Zustand berührte mich eine Hand.
Ich sprang auf und schwang meine Büchse, um den Fremden sogleich mit dem Kolben zu erschlagen – doch seine Stimme hielt mich zurück.
»Bruder«, sagte er, »ich Lenatewa.«
Die sanfte Weise, in der er redete, überzeugte mich, dass er es gut meinte. Ich reichte ihm die Hand. Tränen entströmten meinen Augen, mein Herz war wie gebrochen, und nur schweigend konnte ich zum Hügel deuten und ausrufen:
»Mein Kind, mein Kind.«
»Sei Mann«, sagte er, indem er mich fortzog, »komm!«
»Willst du sie retten, Lenatewa?«
Er antwortete nicht, führte mich aber zum kleinen Teich und zeigte auf den alten Baum, wo ich ihn vor vielen Jahren tödlich verwundet gefunden hatte. Ich wusste, er wollte mir damit andeuten, dass er nicht vergessen habe, was ich einst für ihn tat, und dass er mir helfen werde, wo er nur könne. Das genügte mir freilich nicht. Ich musste wissen, was er zu tun beabsichtigte und welche Hoffnungen er hegte. Aus der Vorsicht, die er walten ließ, mich vom Lager weg zu führen, konnte ich schließen, dass er jene Indianer nicht anführte.
Er fragte mich, ob ich die Bemalung jener Krieger nicht beobachtet hätte. Ich hatte aber nichts gesehen als mein Kind. Dann erfuhr ich, dass es die Partei seines Onkels, jenes schwarzen Häuptlings sei, der ihn vor Jahren hatte ermorden wollen und der von seines Vaters Anhängern erschossen wurde; dass jene ferner seine tödlichsten Feinde wären und jetzt vom Sohn seines Onkels befehligt würden, der geschworen habe, den Tod des Vaters an Lenatewa zu rächen.
Alles dies teilte er mir in wenigen Minuten mit und machte mir dabei begreiflich, dass wir mein Kind nur durch List befreien könnten.
Er hatte zwei Begleiter bei sich, die schon Vorbereitungen dazu trafen. Was dies aber für Vorbereitungen waren, darüber erklärte er sich nicht, und ich musste all meine Geduld zusammennehmen, um sein Handeln abzuwarten – in meiner gegenwärtigen Gemütsverfassung wahrhaftig keine leichte Aufgabe, denn so schnell der Indianer im direkten Gefecht ist, so vorsichtig, kalt und langsam bewegt er sich, wenn es um eine List geht.
Nach einer Weile führte mich Lenatewa um den Hügel herum in eine Schlucht, die mir bis dahin völlig unbekannt gewesen war. Hier standen zu meinem Erstaunen nicht weniger als zwölf Pferde angebunden, die die roten Teufel am selben Tag aus den Niederlassungen gestohlen hatten. Das meinige war auch darunter, was ich jedoch erst entdeckte, als Lenatewa darauf zeigte.
»Dies ihn bald in Bewegung setzen«, sagte er, indem er auf mein Pferd deutete, wodurch ich einen Teil seines Plans erriet. Er wollte aber nicht, dass ich dabei mithalf – jetzt wenigstens noch nicht –, und trug mir auf, das Feuer auf der Höhe zu beobachten, da die Schlucht am Fuß des Hügels lag, auf dem die Indianer lagerten. Gleich einem Schatten bewegte er sich nun weiter, und zwar derart leise und vorsichtig, dass ich bekennen muss, dass ich – obwohl ich mich für einen geschickten Späher hielt – verglichen mit ihm doch nur ein Stümper gewesen wäre.
Schnell hatte er mein Pferd losgebunden, führte es langsam durch die Schlucht um den Fuß des Hügels und halb die gegenüber liegende Anhöhe hinauf. Der Wind wehte vom Lager her, weshalb sie nicht das leiseste von uns ausgehende Geräusch hören konnten; sie schienen aber auch nicht im mindesten darauf zu achten, und doch war ich nie im Leben so voller Angst gewesen wie gerade jetzt.
Ich war nun Lenatewa gefolgt und traf ihn an jenem Ort, wo er das Pferd befestigt hatte, einige hundert Schritte von den Indianern entfernt, auf dem Weg dem Blockhaus zu. Die Schlucht, in der sich die gestohlenen Pferde befanden, musste jenseits des Lagers liegen, woraus ich seinen Plan zu erraten glaubte.
Seine beiden Begleiter stießen zu ihm, einer nach dem andern, und gaben ihm in ihrer Sprache einen langen Bericht. Er teilte mir daraufhin mit, dass drei meiner Gefährten skalpiert worden, der vierte, Hugh Darling, aber entkommen sei; dass dieser die Leute im Blockhaus gewarnt habe und dass Lucy auf meiner Besitzung gefangengenommen worden war, zu der sie ohne Begleitung gegangen sei.
Lenatewa sagte mir, was er zu tun gedenke und auf welche Weise ich mich verhalten solle. Er entfernte sich dann mit seinen Begleitern, und als ich glaubte, sie könnten sich der Schlucht ziemlich genähert haben, schlich ich leise dem Lager zu.
Als ich es bis auf etwa fünfundzwanzig Schritt Entfernung erreicht hatte, hielt ich es für ratsam, ruhig liegen zu bleiben und zu warten. Ich konnte jedes Gesicht unterscheiden, und mein armes Kind totenbleich in ihrer Mitte.
Meine Geduld wurde auf keine lange Probe gestellt, denn bald entstand ein entsetzlicher Lärm unter den gestohlenen Pferden. Ich muss an dieser Stelle anmerken, dass ein Pferd einem Indianer so wertvoll ist wie die Geliebte dem weißen Mann; kaum vernahmen also die Lagernden das Getöse, sprangen sie eiligst auf und jeder lief, schnell nach seinem Pferd zu sehen. Nur ein einziger blieb zurück, den Tomahawk über dem Kopf meines armen Kindes schwingend, als wolle er sie jeden Augenblick erschlagen. Ich konnte die Ärmste beim Schein der Flamme genau erkennen – wie sie in ihrer Todesangst die Hände faltete und betete, da sie jetzt den tödlichen Schlag erwartete.
So sehr es in meinem Innern kochte, musste ich mich doch zurückhalten, bis das Geräusch der Davongeeilten sich verlor. Dann zielte ich auf die Brust des Indianers, der mein Kind bewachte.
Ich zitterte und zog das Gewehr zurück. Ich wusste, dass ich nur den einen Schuss hatte, und wenn dieser fehlging oder nicht tödlich traf, würde der Wilde mit seiner letzten Kraft den Tomahawk in ihrem Schädel begraben.
Ich legte wieder an und fühlte mich mit einem Mal sicher. In diesem Augenblick hörte ich das Geräusch von Menschen und Pferden, weit in der Ferne, und wusste, dass der rechte Moment gekommen war. Die Kugel traf ihr Ziel, und als ich mit dem Messer vorsprang, das Todeswerk zu vollenden, fand ich das bereits getan.
Ich zerschnitt die Bande, die mein Kind an einen Baum fesselten, und sie fiel mir um den Hals und konnte nur die Worte »mein Vater« schluchzen. Einen Augenblick hielt sie mich umschlungen, und mit welchen Gefühlen brauche ich wohl nicht zu sagen.
Dann flohen wir zum bereitstehenden Pferd, und hat das alte Tier seine vier Knochen je gebraucht, war es an diesem Abend. Nach einem scharfen Ritt kamen wir am Blockhaus an, und die arme Betsy freute sich närrisch, ihr Kind und mich, die sie beide schon verloren geglaubt hatte, noch mit natürlichem Skalp zu sehen und an ihr Herz pressen zu können.
Fortsetzung folgt.
Eine kurze Einführung zu William Gilmore Simms gibt es hier. Und für Neueinsteiger geht es auf diesem Weg zum 1. Kapitel.
Der Text folgt weitgehend der 2002 erschienenen Buchausgabe „Wigwam und Blockhaus“ von William Gilmore Simms. Die Grundlage ist die Übersetzung von Friedrich Gerstäcker aus dem Jahr 1846. Sie wurde sorgfältig durchgesehen, gelegentlich verbessert bzw. behutsam um die kleine Staubschicht auf der Sprache von vor 170 Jahren bereinigt, eventuell von Gerstäcker vorgenommene kleinere Kürzungen wurden wieder rückgängig gemacht. Das Copyright dieser Textfassung liegt beim Herausgeber Michael Klein.