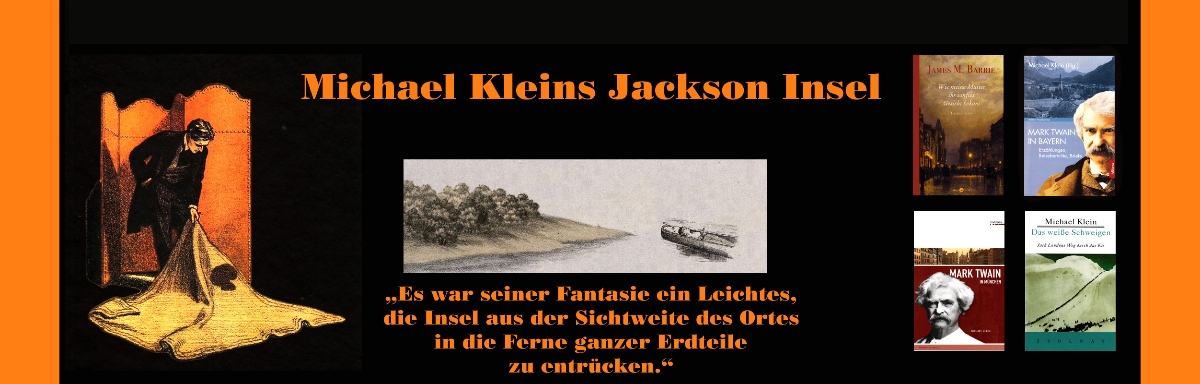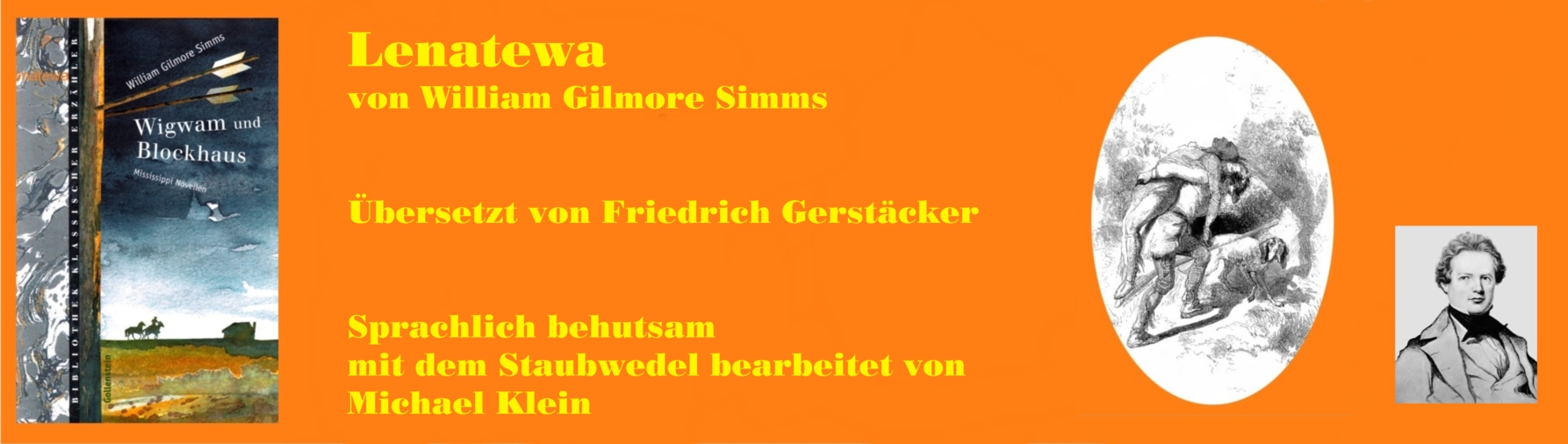
8. Kapitel
Die ausführliche Beschreibung jenes Krieges findet ihr in Büchern und Zeitungen, deshalb beschränke ich mich darauf, jene Einzelheiten zu erzählen, die uns betrafen.
Der junge Häuptling Olaschottee, der Vetter und Feind Lenatewas, hatte die Indianer, die unsere Niederlassungen überfallen sollten, angeführt, und obwohl er nicht erreicht hatte, was er wollte, fügte er uns doch viel Unheil zu. Er zündete unsere Besitzungen an, um uns aus dem Blockhaus zu locken; als ihm dies aber nicht gelang, zog er ab, weil ein Indianer bei einer längeren Belagerung leicht ermüdet. Wir sahen ihn nicht wieder bis zu jenem Frieden, der nach der Niederlage der Indianer bei Echotee rasch zustande kam. Bei letzterer Gelegenheit wurde Lenatewa gefährlich verwundet, doch da die Indianer in der Regel geschickter in derlei Heilungen sind als die Weißen, erholte er sich wieder, wenn auch sehr langsam.
Währenddessen waren wir alle auf unsere Besitzungen zurückgekehrt, pflanzten, bauten und vergaßen die überstandenen schweren Zeiten.
Eines Tages wurden wir von Lenatewas Besuch überrascht, der mit völlig geheilten Wunden zurückkehrte. Er war ein schöner, wohlgewachsener Mann und sah in seiner malerischen Kleidung äußerst stattlich aus. Wir begrüßten ihn alle als einen alten Freund, und er blieb drei Tage bei uns. nahm dann Abschied, kam aber nach einigen Wochen wieder und verweilte abermals drei Tage.
So fuhr er fort, uns von Zeit zu Zeit zu besuchen, bis Betsy mir eines Tages sagte:
»Hör mal, Daniel, Lenatewa kommt nur wegen Lucy so häufig zu uns, glaub‘ mir.«
Als sie mir das mitteilte, erinnerte ich mich, wie ungemein aufmerksam der junge Häuptling gegenüber Lucy war und dass er uns oft verließ, um ihr in den Garten zu folgen. Wenn er ihr wirklich gewogen ist, dachte ich mir allerdings, sollte denn ein so braver Bursche, ein edler, großmütiger, besonnener Indianer nicht ebenso gut sein wie ein Weißer? Betsy wollte davon nichts wissen und ereiferte sich, ihre Tochter solle keinen Wilden, keinen Heiden, keinen Rothäutigen heiraten, solange sie noch ein Wort zu reden habe.
Ich beruhigte sie mit der Bemerkung, dass immer noch Zeit genug sei, dem jungen Häuptling eine Antwort zu geben, wenn er gefragt hätte. Im Übrigen wäre es unsere Schuldigkeit, ihm nach allem, was er für uns getan habe, freundlich zu begegnen.
Betsy war indes anderer Meinung und behauptete, der Stiefel wäre am andern Bein, die Dankbarkeit sei auf seiner Seite und nicht auf der unsrigen, und ich konnte sie nicht einmal dazu bringen, Lenatewa wenigstens mit freundlichen Blicken zu empfangen. Dieser schien sich übrigens nicht viel daraus zu machen, da ich selbst ihm gegenüber stets zuvorkommend war.
Lucy behandelte ihn ebenfalls immer höflich und liebreich, was mich besonders freute. Sie hatte jene entsetzliche Nacht nie vergessen, als sie, von den Feinden gefangengenommen, jeden Augenblick den Tod erwartete und nur durch Lenatewas Mut und List gerettet wurde. Sie ging mit ihm spazieren, unterhielt sich vertraut mit ihm, als wären sie Geschwister, und auch er benahm sich so höflich gegen sie wie ein geborener Franzose.
Ihr könnt glauben, dass es für meine Frau kein erfreulicher Anblick war, die beiden zusammen gehen zu sehen.
»Daniel«, sagte sie, »du musst die jungen Leute im Auge behalten. Ich glaube beinah‘, Lucy hat sich in diesen Indianer verliebt und könnte imstande sein, mit ihm davonzulaufen.«
»Welche Idee!« entgegnete ich, doch das beruhigte sie nicht, und ich war genötigt, ihretwegen die beiden zu beobachten. Wohin sie auch ihre Spaziergänge nahmen, folgte ich ihnen, die Büchse in der Hand. Ich tat dies lediglich Betsy zu Gefallen, weil sie es wünschte und ich stets gern ihre Wünsche erfüllt hatte; aber wäre der Bursche mit dem Mädchen wirklich fortgelaufen, ich hätte nicht auf ihn geschossen. Meiner Ansicht nach wäre Lenatewa ein ebenso guter Mann für meine Tochter geworden wie jeder andere. Soweit sollte es aber leider nicht kommen.
Eines Tages, nachdem er fast eine Woche bei uns zugebracht hatte, sprach er ein paar leise Worte zu Lucy, die darauf ihren Hut nahm und mit ihm hinausging. Ich befand mich gerade in der oberen Kammer, die eher zum Zufluchtsort bei Annäherung der Indianer als zum alltäglichen Aufenthalt bestimmt war.
»Daniel«, rief meine Frau plötzlich, und aus dem Tonfall ihrer Stimme konnte ich erraten, was sie mir sagen wollte. Ich war jedoch gerade im Begriff, etwas anderes zu tun, auch war es mir, wie schon gesagt, unangenehm, hinter einem Freund herzuschleichen. Ich begnügte mich daher damit, die beiden durch eine der Schießscharten zu beobachten.
In der Tat fürchtete ich weder von Lenatewa, noch von meiner Tochter, dass sie einfach durchbrennen könnten, und obwohl Lucy ihn liebreich behandelte, hielt ich dies für eine natürliche Folge ihres sanften Gemüts und der Verpflichtung, die sie ihm für alles, was er für uns getan hatte, schuldete. Und als ich sie auf und ab wandern sah, kam mir immer aufs Neue der Gedanke, was für ein hübsches Paar sie abgeben würden.
Beide waren stattlich und schlank, und ein schöneres Mädchen als Lucy lebte in der ganzen Niederlassung nicht. Auch Lenatewa hatte das edelste und schönste Äußere, das ich je bei einem Wilden gesehen habe, denn ein besonnener Indianer ist ein so edles Geschöpf, wie es der liebe Gott nur erschaffen hat. So stolz, so kühn, so keck in allen seinen Bewegungen, immer als ob er im Begriff sei, irgendeine große Tat zu vollführen und dabei wisse, dass die ganze Welt ihr Auge auf ihn gerichtet habe. Ich wusste überdies, dass Lenatewa nicht nur so edel erschien, sondern es auch wirklich war.
Wie sie so nebeneinander gingen, den Kopf etwas geneigt, zuckte mir durchs Hirn: Wie, wenn er ihr gerade jetzt seine Gefühle enthüllte, wenn auch sie ihn lieber hätte als sonst jemand auf der Welt? Und wenn sie in dieser Hinsicht meine Meinung teilte?
Ich dachte ferner: Gibt es einen schöneren Anblick im Leben, als ein junges Paar, dessen gegenseitige Liebe mit aller Wärme erwacht ist, und das, beseelt von diesem Gefühl, in der Unschuld seiner Herzen unter dem Schatten so hoher, herrlicher Bäume dahin wandelt?
Ich setzte mich nieder, legte meine Büchse auf die Knie und folgte ihnen bewegt mit meinen Blicken, bis mir Tränen in die Augen traten. Ich sah, wie sie auf und ab gingen, sah, wie Lenatewa beim Reden seine Hand bewegte, was angesichts der äußeren Ruhe des Indianers nicht häufig der Fall ist, und überlegte, was ich beschließen solle, wenn er wirklich Lucy zur Frau begehre und sie ihm nicht abgeneigt sei. Was sollte ich tun? Konnte ich sie ihm abschlagen? Und konnte ich »Ja« sagen, wenn Betsy »Nein« wollte?
Während mich diese Gedanken beschäftigten, hatte ich die jungen Leute aus dem Blickfeld verloren; da hörte ich plötzlich einen lauten Schrei und einen gellenden Ruf, als hätte ihn Lenatewa ausgestoßen. Ich sah schnell um mich, erstarrte aber beinahe angesichts des Anblicks, der sich mir bot.
Lucy lag ausgestreckt auf dem Boden, und Lenatewa taumelte wie tödlich verwundet zurück, während ein anderer Indianer, seinen Tomahawk schwingend, auf ihn zustürzte und einmal, zweimal, dreimal den Kopf des unglücklichen jungen Häuptlings traf. Aus der schwarzen Färbung seines Gesichts, dem roten Kreis um die Augen und der Adlerfeder im Haar erriet ich, dass es Olschottee war, der den Tod seines Vaters und seine Rache nicht vergessen hatte – und wann vergäße dies je ein Indianer!
Natürlich saß ich nicht tatenlos da, während ein Freund von mir niedergeschossen wurde und meine Tochter halbtot danebenlag. Blitzschnell riss ich die Büchse an die Wange, und der Angreifer bekam den bleiernen Boten augenblicklich und fiel in derselben Sekunde mit seinem Opfer.
Ich stieß dann einen Schrei aus, als sei ich selbst ein Wilder, und eilte auf den Platz hinaus, nach meinem Kind zu sehen. Mit Lenatewa war es schon zu Ende, der hatte seinen Abschied für dieses Leben. Zwar zuckte er noch und stöhnte und seufzte und gab Laute von sich, als ob er eine Art Sterbelied singen wollte, man konnte aber nichts mehr verstehen, und nach kurzem Krampf und Zittern war der Todeskampf vorbei.
Meine Kugel hatte schneller gewirkt, denn Olschottee lag, als ich zu ihm kam, tot und starr da wie eine Ratte.
Lucy war nicht verwundet, weder durch Kugel, noch durch Tomahawk – das Herz hatt’ es ihr aber getroffen, und ob es nun der Schock gewesen war oder sie noch tiefere Gefühle für den jungen Häuptling gehabt hatte, als wir beide ahnten, weiß ich nicht zu sagen, und ich war nie Manns genug, sie zu fragen. Sie lachte jedoch nie mehr und blieb unverheiratet, soviel ist sicher, und hatte doch öfter – und so gute – Gelegenheit dazu gehabt wie jedes andere Mädchen in der Ansiedlung.
Aber Ihr habt sie ja selbst gesehen – und ist sie nicht eine Schönheit? Und – wenn ich’s auch selber sage – die wahre Blume des Waldes?

William Gilmore Simms (Ausschnitt aus einem Ölgemälde eines unbekannten Künstlers)
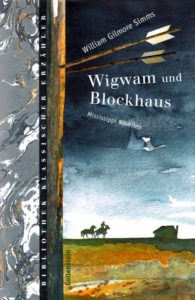
Eine kurze Einführung zu William Gilmore Simms gibt es hier. Und für Neueinsteiger geht es auf diesem Weg zum 1. Kapitel.
Der Text folgt weitgehend der 2002 erschienenen Buchausgabe „Wigwam und Blockhaus“ von William Gilmore Simms. Die Grundlage ist die Übersetzung von Friedrich Gerstäcker aus dem Jahr 1846. Sie wurde sorgfältig durchgesehen, gelegentlich verbessert bzw. behutsam um die kleine Staubschicht auf der Sprache von vor 170 Jahren bereinigt, eventuell von Gerstäcker vorgenommene kleinere Kürzungen wurden wieder rückgängig gemacht. Das Copyright dieser Textfassung liegt beim Herausgeber Michael Klein.