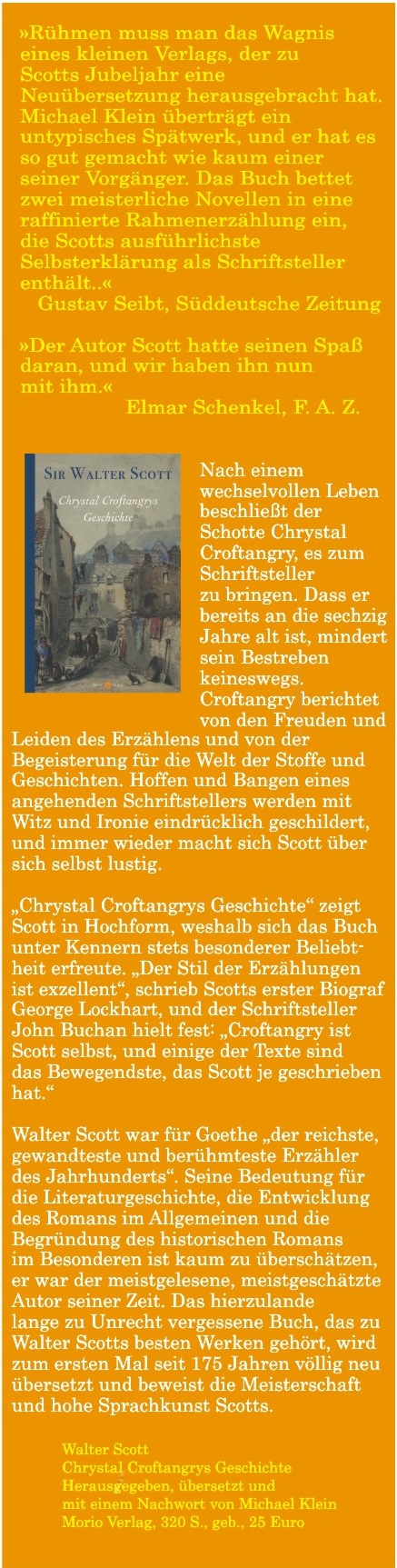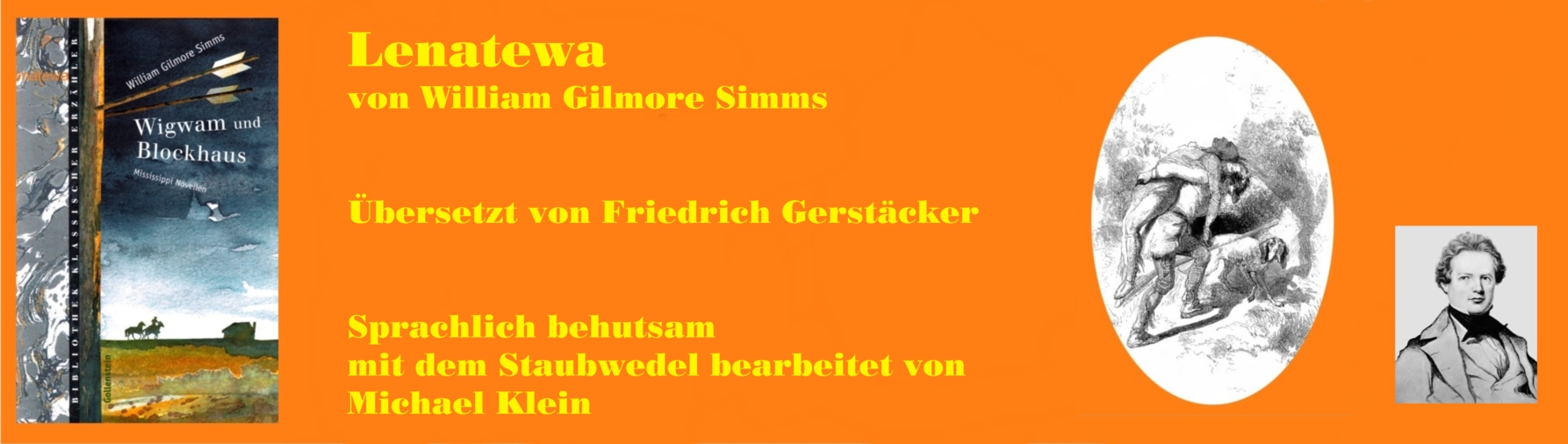
1. Kapitel
An der Grenze zwischen Nord- und Süd-Carolina leben wahrscheinlich noch einige betagte Leute, die sich des alten, ehrwürdigen Daniel Nelson erinnern, der, hoch an Jahren, um 1817 herum dort lebte. Zu jener Zeit zog er von da fort nach Mississippi, wo er, wie wir glauben, innerhalb dreier Monate, nachdem er seinen Wohnort geändert hatte, starb, einem alten Baum ähnlich, der keine Verpflanzung mehr erträgt, sondern eingeht. Daniel kam in seiner Jugend aus Virginia und war einer der ersten, die sich in den südlichen Grenzgebieten Nord-Carolinas niederließen und später in jener Gegend den größten Teil ihres Lebens verbrachten.
Zu jener Zeit war nicht nur das ganze Land Wald, sondern auch noch von vielen Indianern bewohnt, und mehrere Stämme hatten dort ihr bevorzugtes Jagdrevier. Dieser Umstand schreckte indes Nelson nicht ab. Er selbst war noch ein kräftiger, breitschultriger junger Mann mit feurigem Auge und gleich feuriger furchtloser Seele, und er hatte – wenn auch wenige –- Gefährten, die ihm in all diesem kaum nachstanden, denn der Geist des alten Daniel Boone war damals verbreiteter, als man wohl glaubt. Das Abenteuer lockte ihre Herzen, die Gefahr schien sie in ihrem Leben nur noch zu bestärken und die Härten und Mühsal ihr kräftiger Körper gerade zu beghren.
Nachdem sie die Gegend durchstreift, Wild in Massen erlegt, Bären und Büffel, Rehe und Truthähne, die es zu jener Zeit im Überfluss gab, gekostet hatten, kehrten sie noch einmal zurück, um sich das Nötigste für einen tapferen Waldbewohner zu holen, nämlich eine gute, muntere, furchtlose Frau, die – dem Weib in der Schrift gleich – dem Mann ihrer Neigung folge, wohin er auch gehe. Diese jungen, kühnen Jäger fürchteten sich nicht, in Gegenden, die so entfernt vom sicheren Schutz der Zivilisation waren, eine Heimat zu gründen. Sie hatten mit den Indianern Bekanntschaft und eine Art Freundschaft geschlossen, doch mag sie das Bewusstsein ihrer stärker befestigten Behausungen, ihres größeren Mutes und ihrer besseren Waffen verführt haben, ein wenig zu gering von den Wilden zu denken, ohne sich deshalb doch in trügerischer Sicherheit zu wiegen. Ihre Blockhäuser waren darauf eingerichtet, sich im Notfall in Festungen zu verwandeln; auch wohnten sie nicht zu entfernt voneinander, damit sie sich gegenseitig zu Hilfe kommen konnten. Mit einem Vorrat Bärenfleisch und Wild stets verproviantiert, wurden diese kleinen Festungen dadurch in die Lage gesetzt, sich für den Fall, dass sie von den in Gruppen umherstreifenden Indianern belagert würden, mehrere Monate lang zu halten.
Auf solche Weise nahmen die kühnen Ansiedler Besitz von dem Boden und bereiteten einer mächtigen Nachkommenschaft den Weg. Obgleich sie lieber auf der Jagd und der ermüdenden Landarbeit eher abgeneigt waren, versäumten sie doch auch in dieser Hinsicht ihre Aufgaben nicht. Die dem Wald abgewonnenen Ländereien dehnten sich mit jedem Jahr mehr aus. Mais hatten sie in Fülle zu ihrem Bärenfleisch, und die zunehmenden Bequemlichkeiten zeugten vom wachsenden Wohlstand der Ansiedler. Nach und nach wurden sie auch unbesorgter, was die Nachbarschaft der Wilden anging, und ließen nach in ihrer Wachsamkeit, mit der sie früher jede Annäherung auch der freundschaftlich gesinnten Stämme beobachtet hatten. Fünf Jahre ungestörter Ruhe rechtfertigten freilich das Vertrauen, das sie mit der Zeit zu ihren wilden Nachbarn gefasst hatten und das sie im Gefühl der Sicherheit ihrer eigenen Lage bestärkte.
Am Ende dieses Zeitraums jedoch schienen sich die Dinge anders gestalten zu wollen. Die Indianer wurden unruhig. Entferntere Stämme, die verstärkt in Berührung mit den größeren Niederlassungen der Weißen kamen, von diesen im Handel übervorteilt oder durch Alkohol demoralisiert wurden, beklagten sich über ihr Unglück und das Unrecht, das ihnen angetan wurde, oder hatten vielleicht auch, angezogen von den Habseligkeiten der Weißen, das Verlangen, diese Schätze in Masse zu besitzen, die ihnen bis dahin nur in geringem Maß zuteil wurden. Ihre Klagen und Wünsche teilten sie ihren im Innern lebenden Brüdern mit, und unsere Ansiedler wurden durch die Veränderungen, die sie in ihrem Umgang mit den verschiedenen Stämmen und in deren Gesinnungen wahrnahmen, oft beunruhigt.
Wir wollen uns nicht mit einer ausführlichen Beschreibung der sich vorbereitenden Feindseligkeit aufhalten, die schon an anderen Orten hinreichend beschrieben worden ist – genug, dass unsere kleine Kolonie sie bald bemerkte und insbesondere Daniel Nelson ein Auge darauf hatte. Er wurde besorgt, aber nicht ängstlich, und während er sich als guter Ehemann bemühte, seine Frau durch seine Mitteilung nicht zu erschrecken, hielt er es doch für seine Pflicht, sie auf das Schlimmste vorzubereiten. Nachdem er dies getan hatte, fühlte er sich etwas erleichtert, doch wenn er sein fünfjähriges Mädchen aufs Knie nahm und den kleinen Jungen auf dem Schoß der Mutter anblickte, erneuerte sich seine Besorgnis. Er entschloss sich daher, die in letzter Zeit vernachlässigten Vorsichtsmaßnahmen wieder aufzunehmen, und sobald er das Abendessen eingenommen hatte, steckte er sein Jagdmesser zu sich, nahm seine Flinte und rief seinen treuen Hund Clinch, um den Wald in der Nähe seiner Wohnung zu durchstreifen.
Bei dieser Beschäftigung verstrich einige Zeit, und da die Luft mild war und ein glänzender Sternenhimmel die Nacht erhellte, er sich auch in etwas zu unruhiger Gemütsstimmung fand, entschloss er sich, durch den Wald in Richtung der etwa vier englische Meilen entfernten Niederlassung Jacob Ransoms zu gehen, um ihn – und durch ihn seine übrigen Gefährten – auf die Notwendigkeit der Wiederaufnahme ihrer früheren Wachsamkeit aufmerksam zu machen.
Die Ereignisse dieser Nacht überlassen wir nun seiner eigenen Mitteilung, wie wir sie ihn hundertmal haben erzählen hören – und zwar in einem Alter, in dem er, dem Grab nahe, weder eine Unwahrheit, noch sonst etwas gesagt haben würde, von dem er nicht selbst fest überzeugt gewesen wäre.
Fortsetzung folgt: Kapitel 2 demnächst an dieser Stelle.
Eine kurze Einführung zu William Gilmore Simms gibt es hier.
Der Text folgt weitgehend der 2002 erschienenen Buchausgabe „Wigwam und Blockhaus“ von William Gilmore Simms. Die Grundlage ist die Übersetzung von Friedrich Gerstäcker aus dem Jahr 1846. Sie wurde sorgfältig durchgesehen, gelegentlich verbessert bzw. behutsam um die kleine Staubschicht auf der Sprache von vor 170 Jahren bereinigt, eventuell von Gerstäcker vorgenommene kleinere Kürzungen wurden wieder rückgängig gemacht. Das Copyright dieser Textfassung liegt beim Herausgeber Michael Klein.
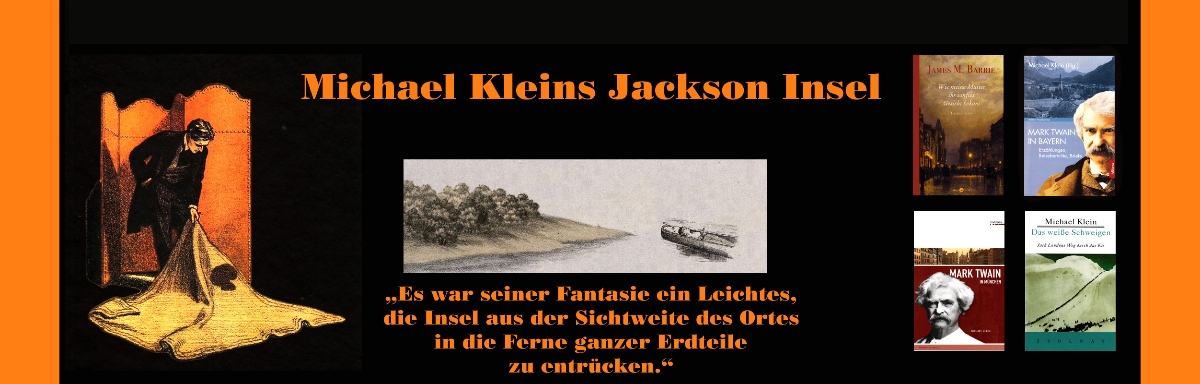

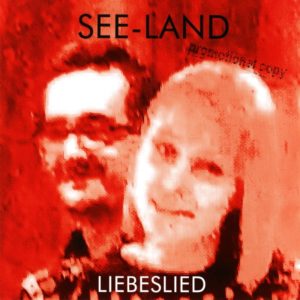 Der Einstieg ist das titelgebende „Liebeslied“, ein niveauvoller Ohrwurm, eine angenehm verhaltene Hymne mit poetisch-gewitztem Text und stillem Jubel, denn da finden sich gerade zwei. Man achte auf den Beginn, ohne Intro, ohne Umweg, stark und treffend wie die Liebe auf den ersten Blick.
Der Einstieg ist das titelgebende „Liebeslied“, ein niveauvoller Ohrwurm, eine angenehm verhaltene Hymne mit poetisch-gewitztem Text und stillem Jubel, denn da finden sich gerade zwei. Man achte auf den Beginn, ohne Intro, ohne Umweg, stark und treffend wie die Liebe auf den ersten Blick. „
„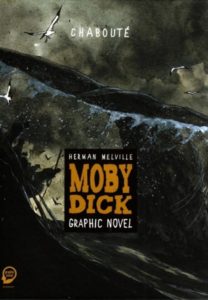 Der 1967 im Elsass geborene französische Comic-Zeichner und Illustrator Chabouté hat den Stoff als große Graphic Novel adaptiert. Die Qualität des Beginns ist freilich noch ungleichgewichtig. Ismael, die Erzählerfigur, kommt beispielsweise mit Glubschaugen, Knollennase und tiefgezogenen Mundwinkeln daher, was ihm kein melancholisches, sondern ein tranfunzeliges Aussehen verleiht. Überhaupt liegt anfangs eine Schwäche in der ungenügenden Gesichterausformung und in ihren zu häufig effekthascherisch statisch-stieren Blicken. Andererseits überzeugen die kontrastreichen SW-Bilder von Beginn an in den wortlosen, scherenschnitt-artigen Schatten-Passagen, die ungeheure Dramatik entfalten.
Der 1967 im Elsass geborene französische Comic-Zeichner und Illustrator Chabouté hat den Stoff als große Graphic Novel adaptiert. Die Qualität des Beginns ist freilich noch ungleichgewichtig. Ismael, die Erzählerfigur, kommt beispielsweise mit Glubschaugen, Knollennase und tiefgezogenen Mundwinkeln daher, was ihm kein melancholisches, sondern ein tranfunzeliges Aussehen verleiht. Überhaupt liegt anfangs eine Schwäche in der ungenügenden Gesichterausformung und in ihren zu häufig effekthascherisch statisch-stieren Blicken. Andererseits überzeugen die kontrastreichen SW-Bilder von Beginn an in den wortlosen, scherenschnitt-artigen Schatten-Passagen, die ungeheure Dramatik entfalten.
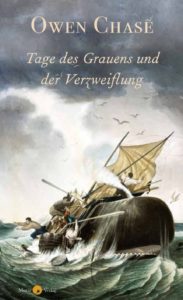 Die Männer vom Walfänger „Essex“ trauen ihren Augen nicht, und sie sind derart ungläubig, dass sie die Gefahr erst im letzten Moment begreifen. Mitten in der Waljagd sehen sie sich dem Ansturm eines gewaltigen Tieres ausgesetzt, das – dergleichen hat es zuvor nie gegeben, zumindest hat nie ein Walfänger Vergleichbares berichten können – den Spieß herumdreht. Statt eilends den Harpunen der Walfangboote davonzuschwimmen, wendet sich der Wal mehrmals bewusst dem Hauptschiff zu und rammt frontal dessen Bug. Ein gewaltiges Leck im Schiffsrumpf ist die Folge. Keine Rettung für das Schiff – tausend Meilen vom nächstgelegenen Land entfernt, und die »Essex« sinkt.
Die Männer vom Walfänger „Essex“ trauen ihren Augen nicht, und sie sind derart ungläubig, dass sie die Gefahr erst im letzten Moment begreifen. Mitten in der Waljagd sehen sie sich dem Ansturm eines gewaltigen Tieres ausgesetzt, das – dergleichen hat es zuvor nie gegeben, zumindest hat nie ein Walfänger Vergleichbares berichten können – den Spieß herumdreht. Statt eilends den Harpunen der Walfangboote davonzuschwimmen, wendet sich der Wal mehrmals bewusst dem Hauptschiff zu und rammt frontal dessen Bug. Ein gewaltiges Leck im Schiffsrumpf ist die Folge. Keine Rettung für das Schiff – tausend Meilen vom nächstgelegenen Land entfernt, und die »Essex« sinkt.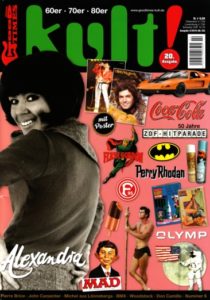
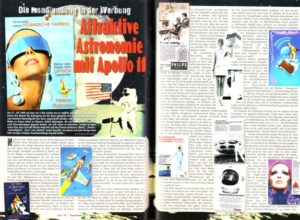
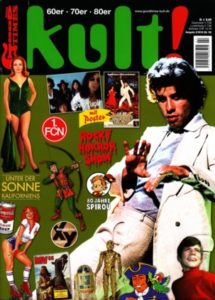 Übrigens bringt
Übrigens bringt 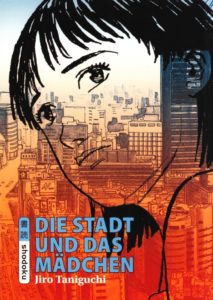 Shiga bricht sofort nach Tokio auf und beginnt seine Nachforschungen. Während für die Polizei der Fall des verschwundenen Mädchens von keinem sonderlichen Interesse zu sein scheint, gewinnt Shiga das Vertrauen eines jungen Straßenstreuners und des zunächst abgebrüht-abweisenden Mädchens Maki Ohara, das Megumi zuletzt gesehen hat.
Shiga bricht sofort nach Tokio auf und beginnt seine Nachforschungen. Während für die Polizei der Fall des verschwundenen Mädchens von keinem sonderlichen Interesse zu sein scheint, gewinnt Shiga das Vertrauen eines jungen Straßenstreuners und des zunächst abgebrüht-abweisenden Mädchens Maki Ohara, das Megumi zuletzt gesehen hat.